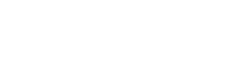Hochleistungsrechenzentren haben in der Regel einen hohen CO₂-Ausstoß. Das muss jedoch nicht so sein. Wie die folgenden Beispiele zeigen, können sie sogar einen positiven CO₂-Fußabdruck erzielen.
Im European Green Deal hat sich die Europäische Union das Ziel gesetzt, der erste klimaneutrale Kontinent zu werden. Bis 2030 sollen die Netto-Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um mindestens 55 Prozent sinken und bis zum Jahr 2050 Netto-Null erreichen. Dies soll unter anderem durch eine umweltgerechte und intelligentere Mobilität, die Förderung einer klimaneutralen Industrie und einen höheren Anteil erneuerbarer Energien erzielt werden.
Bei der Umsetzung spielt die rechenintensive Spitzenforschung eine wichtige Rolle. Supercomputer können dabei helfen, neue Materialien, Verfahren und Prozesse zu entwickeln, um Produkte und Dienstleistungen nachhaltig und klimaneutral anbieten zu können. Im European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) haben sich deshalb die Europäische Union, die Mitgliedsstaaten und Unternehmen aus der Privatwirtschaft zusammengeschlossen, um ein europäisches Ökosystem für HPC-Rechenzentren aufzubauen. Supercomputer sollen aber nicht nur die Spitzenforschung vorantreiben, sondern selbst mit gutem Beispiel vorangehen und so nachhaltig wie möglich werden. Durch die Forschung an grünen Projekten können sie sogar einen positiven CO2-Fußabdruck erreichen.
Faktoren für nachhaltiges Supercomputing
Europäische Supercomputer wie LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) oder das Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) gehören nicht nur zu den leistungsfähigsten HPC-Umgebungen der Welt, sondern auch zu den nachhaltigsten. Das LUMI-Rechenzentrum im finnischen Kajaani belegt aktuell Platz acht in der Top-500-Liste der leistungsstärksten HPC-Umgebungen und zählt zu den 25 umweltfreundlichsten (Stand November 2024). Es wurde bereits mehrfach für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet, unter anderem mit dem „Best Sustainability Innovation Award“ 2021, dem „Reader’s and Editor’s Choice Award“ der Zeitschrift HPCwire 2022 und dem „Green Data Centre of the Year Award“ 2023. Auch der Supercomputer „Hawk“ des HLRS gehört zu den 100 leistungsfähigsten und grünsten HPC-Umgebungen weltweit. Mit dem Exascale-Supercomputer „Herder“ (HLRS III) soll bis 2027 ein noch schnellerer Rechencluster entstehen, der durch die Kombination von nachhaltigen Materialien, Photovoltaikanlagen und dynamischem Energiemanagement besonders energieeffizient arbeiten wird. Das HLRS wurde 2024 für seine nachhaltige Strategie und das visionäre Neubauprojekt mit dem Datacenter Strategy Award in der Kategorie Transformation ausgezeichnet.
Entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz von Supercomputern ist die zugrundeliegende Rechenarchitektur. LUMI ist ein sogenannter Tier-0 GPU-beschleunigter Supercomputer. Er basiert auf der HPC-Plattform HPE Cray mit AMD Instinct Beschleunigern und AMD EPYC CPUs. Die technischen Details der LUMI-Architektur wurden bereits in diesem Artikel beschrieben.
Das aktuelle Flaggschiff des HLRS, der Supercomputer Hunter, basiert ebenfalls auf einer Cray-Plattform und verfolgt einen GPU-orientierten Ansatz. Das Herzstück bilden AMD Instinct MI300A Beschleuniger, die eine theoretische Spitzenleistung von 48,1 PFLOP/s (Billionen Floating Operations pro Sekunde) ermöglichen. Hunter ist damit fast doppelt so schnell wie das bislang leistungsfähigste HLRS-System, Hawk, wobei der Energiebedarf bei Spitzenleistung um 80 Prozent gesenkt werden konnte. Eine wesentliche Rolle spielt dabei von HPE und HLRS gemeinsam entwickelte dynamische Leistungsbegrenzung. Sie berücksichtigt die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Anwendungen wie Simulationen oder Datenanalysen und gleicht diese so an das verfügbare Leistungsbudget an, dass eine optimale Auslastung und eine möglichst hohe Energieeffizienz erreicht werden.
Weniger CO₂-Ausstoß durch mehr Effizienz und neue Verfahren
Die HPC-Systeme in Kajaani und Stuttgart arbeiten nicht nur selbst möglichst energieeffizient und klimaneutral, sie bilden auch die Basis für grüne Projekte, die zu weniger CO₂-Ausstoß und mehr Nachhaltigkeit führen können. So erforscht Karoliina Honkala von der finnischen Jyväsklyä-Universität am LUMI, wie sich die Produktion von grünem Wasserstoff effizienter machen lässt. Das Projekt kombiniert computergestützte Modellierung und experimentelle Untersuchungen, um die Wasserspaltung in porösen Kohlenstoffstrukturen auf mikroskopischer Ebene verstehen und neue Materialien entwickeln zu können. Der tschechische Wissenschaftler Tomáš Blejchař will mithilfe neuronaler Netze das Design vertikaler Pumpen optimieren. Ziel ist es, vor allem solche Systeme effizienter zu machen, die im Dauerbetrieb laufen, etwa in Wasser- und Abwassersystemen, Heizungen oder Klimaanlagen. Bereits kleine Optimierungen können hier schon zu einer erheblichen Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen.
Strömungsmechanische Fragestellungen stehen im Mittelpunkt des CFD-Projekts (Computer Fluid Dynamics), das vom Ingenieur- und Architekturbüro Sweco durchgeführt wird. Durch die Simulation von Strömungsgeschwindigkeit, Druck und Turbulenzen sollen Systeme zur Verteilung von Luft und Flüssigkeiten optimiert werden. Die Erkenntnisse könnten positive Auswirkungen auf die Energieeffizienz von Rechenzentren, die Sicherheit von Wasserstoffkraftwerken, die Luftqualität in Wohn- und Bürogebäuden, die Frischluftzufuhr in Städten oder die Effektivität und Umweltfreundlichkeit von Fischtreppen haben.
Seit 2023 koordiniert das HLRS das Forschungsprojekt WindHPC. Ziel ist es, Strategien zur optimalen Nutzung überschüssiger Energie aus Windkraftanlagen zu entwickeln. Aktuell werden rund sechs TWh Windstrom pro Jahr aufgrund fehlender Netzkapazitäten abgeregelt. Das Projekt untersucht, wie in Windkraftanlagen integrierte Rechencluster diese überschüssige Energie zukünftig direkt vor Ort nutzen könnten. Dafür analysieren die Forscher anhand von Simulationen, wie sich Rechenaufgaben innerhalb einer verteilten Architektur optimal zuweisen lassen, wie die gewonnenen Daten verwaltet werden können und welche Algorithmen sich am besten für das verteilte Rechnen eignen.
Wissenschaftler der TU Berlin generieren auf dem Supercomputer Hawk thermodynamische Daten, die zu einem besseren Verständnis des Moleküls Ammoniak (NH3) beitragen sollen. Ammoniak spielt nicht nur in der Düngemittelproduktion, zur Kühlung und als Reinigungsmittel eine wichtige Rolle, sondern auch als potenzielle Basis für neue erneuerbare Kraftstoffe. Die Forschenden untersuchen, wie sich die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Ammoniak verändern, wenn es mit anderen Molekülen gemischt wird. Ziel ist es, Verarbeitungsprozesse zu optimieren und neue Technologien auf Ammoniakbasis zu entwickeln.
Überraschende Ergebnisse lieferte eine Analyse der Moleküldynamik in Solarzellen, die Wissenschaftler der Universität Paderborn am HLRS durchführten. Ziel war es, die Effizienz von Solarmodulen zu steigern, indem hochenergetische Photonen mit bis zu drei Elektronenvolt (eV) besser genutzt werden. Aktuelle Module auf Siliziumbasis können maximal 1,1 eV in Strom umwandeln, der Rest geht als Wärme verloren. Die Forschenden konnten zeigen, dass unvollkommene, nicht gesättigte Atome als Schnittstelle den Energietransfer verbessern. Das widerspricht der gängigen Annahme, dass solche Atome zu Ineffizienzen an elektronischen Grenzflächen führen. Die Paderborner Wissenschaftler sind zuversichtlich, durch die Einführung solcher unvollkommener Schnittstellen den Wirkungsgrad von Solarzellen deutlich verbessern zu können.
Fazit: CO₂-Reduktion ist auch eine Frage der Spitzenforschung
Mit Supercomputern wie LUMI und Hawk lassen sich viele Probleme bearbeiten, deren Lösung sich positiv auf das Leben, die Sicherheit und die Gesundheit von Menschen auswirken kann. So nutzen Forschende Supercomputer etwa, um Klimakatastrophen genauer vorhersagen oder Krebserkrankungen besser diagnostizieren zu können.
Wie die in diesem Artikel genannten Beispiele zeigen, können Forschungsprojekte auf Supercomputern aber auch direkt zu einem verringerten CO₂-Fußabdruck beitragen. Um tatsächlich einen positiven Nettoeffekt zu erzielen, müssen die Supercomputer selbst jedoch möglichst energieeffizient und nachhaltig betrieben werden. Neben dem Einsatz erneuerbarer Energien und einem intelligenten Rechenzentrumsdesign spielt dabei die Wahl der Computerhardware eine entscheidende Rolle. AMD Instinct Beschleuniger auf Basis der hochintegrierten CDNA 3-Architektur bieten eine Rechengeschwindigkeit von bis zu 5,22 PFLOP/s und sind damit optimal für den Aufbau von HPC-Umgebungen geeignet. AMD EPYC Prozessoren gehören nicht nur zu den leistungsstärksten CPUs, sondern auch zu den energieeffizientesten. Rechenzentren, die AMD EPYC Prozessoren einsetzen, verbrauchen daher bei gleicher Leistung weniger Strom und produzieren weniger Treibhausgase. Es ist also nicht verwunderlich, dass Supercomputer auf AMD-Basis zu den leistungsstärksten und umweltfreundlichsten HPC-Systemen der Welt zählen.